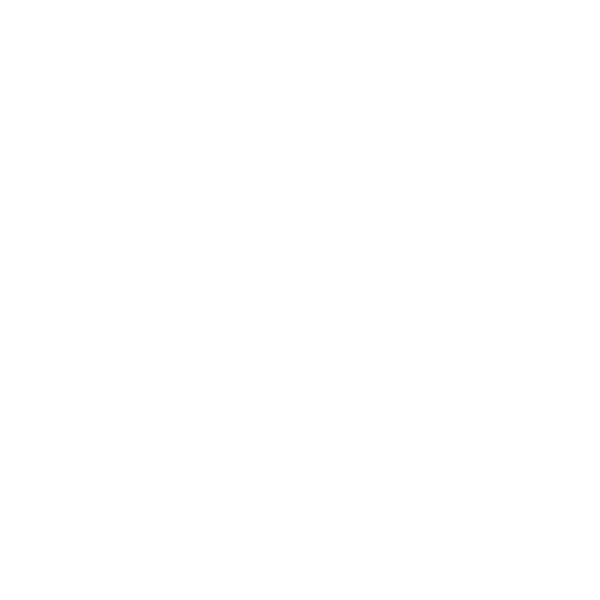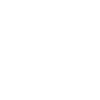01.10.2025
Eine erste Analyse der geplanten Neuerungen für Energiegemeinschaften
Sie sind Gründer, Teilnehmer oder Organisator einer Energiegemeinschaft oder wollen in der Zukunft ein Energy-Sharing-Modell zur Steigerung von Synergien und Effizienzen in Ihrem Unternehmen, Ihrer Immobilie oder Ihrer Gemeinde implementieren? Das neue ElWG könnte – wie der nachstehende Beitrag zeigt – sowohl Chancen als auch Risiken für Ihr Vorhaben mit sich bringen.
Hintergrund
Das von der österreichischen Bundesregierung als “umfassendste Reform am Energiemarkt der letzten zwei Jahrzehnte” bezeichnete Gesetzesvorhaben geht (womöglich) diesen Herbst in die nächste Phase. Am 15.08.2025 endete nämlich die vierwöchige Begutachtungsfrist des lang herbei-gesehnten Pakets des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG), das trotz der Urlaubssaison von vielen Seiten ausgiebig diskutiert und kommentiert wurde. Mit dem ElWG-Paket sollen insbesondere auch Neuerungen im Zusammenhang mit Energiegemeinschaften und ähnlichen Energy-Sharing-Modellen eingeführt werden, welche auch Auswirkungen auf die derzeit bereits implementierten Energy-Sharing-Modelle haben könnten.
In Österreich gibt es nach aktuell geltender Rechtslage folgende Modelle zur Umsetzung der gemeinsamen Nutzung von Stromerzeugungsanlagen:
- Seit 2017 gibt es die Möglichkeit im Rahmen einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage (GEA) Strom durch mehrere Personen zu produzieren und gemeinschaftlich zu verwerten. Voraussetzung dafür ist die Nutzung eines gemeinsamen Netzanschlusses (beispielsweise in einem Mehrparteienhaus) sowie der Abschluss eines (GEA-)Vertrags iSd § 16a Abs 4 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010). Die Gründung eines eigenen Rechtsträgers (z.B. einer GmbH, einer Genossenschaft oder eines Vereins) ist für die Umsetzung einer GEA allerdings nicht erforderlich.
- Durch den im Jahr 2021 geschaffenen Rechtsrahmen (konkret dem Erlass des Erneuerbare-Ausbau-Gesetzes (EAG) sowie einer Novelle des ElWOG 2010) ist es auch möglich gewor-den, elektrische Energie über Grundstücksgrenzen hinweg durch die Teilnahme an soge-nannten Energiegemeinschaften in Österreich gemeinsam zu nutzen. Dabei wird zwischen Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) und Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften (EEG) un-terschieden, wobei für deren Umsetzung entsprechend derzeitiger Gesetzeslage die Grün-dung eines eigenen Rechtsträgers (beispielsweise einer Genossenschaft oder eines Ver-eins) erforderlich ist.
Seit 4 Jahren erleben diese Modelle der gemeinsamen Nutzung von Stromerzeugungsanlagen, insbesondere im kommunalen Bereich, einen regelrechten Boom. Derzeit sind laut Österreichischer Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften über 9.000 Energiegemeinschaften (GEA, EEG und BEG) in Österreich registriert, davon ca. 5.000 EEG und BEG.
Mit dem neuen ElWG soll nun auch die Möglichkeit geschaffen werden, über Grundstücksgrenzen hinweg gemeinsam Energie auf rein vertraglicher Basis zu nutzen und zu teilen, und zwar ohne Gründung einer Energiegemeinschaft. Vor diesem Hintergrund soll der sogenannte “Peer-to-Peer Handel” (P2P) eingeführt werden, also der Handel zwischen “Gleichgestellten” (Peers). Damit sollen Berechtigte von Erzeugungsanlagen ihren Stromüberschuss direkt anderen Marktteilnehmer:innen zur Verfügung stellen können, was vor allem auch das niederschwellige Energy-Sharing erleichtern soll. Das P2P-Modell könnte damit ein bedeutender Schritt in Richtung dezentraler Energieversorgung sein.
Doch was bedeuten das P2P-Modell und die sonstigen Änderungen im neuen ElWG für das Modell der Energiegemeinschaften und werden diese auf Grund ihrer komplexen Ausgestaltung nicht ad absurdum geführt?
P2P-Verträge
Die Grundidee des P2P-Modells ist simpel: Wenn jemand nicht an einer GEA, EEG oder BEG teilnehmen möchte oder es keine gemeinschaftliche Initiative im Nahebereich dazu gibt, kann nun auch ein einfacher, bilateraler Vertrag zwischen einem/einer Berechtigten einer Erzeugungsanlage und einem/einer anderen Marktteilnehmer:in über die Zurverfügungstellung von erneuerbarer Energie abgeschlossen werden. Das P2P-Modell soll es also ermöglichen, noch einfacher und unbürokratischer gemeinsam Strom zu nutzen.
Die Regelungen im ElWG-Entwurf im Zusammenhang mit P2P-Verträgen sind allerdings (noch) sehr spärlich und sehen lediglich vor, dass der P2P-Vertrag Bedingungen für die Abwicklung und Abrechnung zu enthalten hat, wobei die Abrechnung auch über einen Dritten (sogenannten Aggregator) erfolgen kann. Sowohl aus dem ElWG-Entwurf selbst als auch aus den Erläuterungen zum ElWG-Paket geht aber hervor, dass im Rahmen des P2P-Konzepts auch das Verschenken von Strom zulässig sein soll. Ebenso soll die Übertragung von Strom zwischen zwei Zählpunkten, die einem/einer einzelnen Marktteilnehmer:in zugeordnet sind, und zwar auch ohne Vertrag, zulässig sein. Mit der Umsetzung des P2P-Konzepts könnte es also auch möglich werden, im Konzern erzeugten Strom vereinfacht und effizient durch die einzelnen Konzernunternehmen zu nutzen oder beispielsweise Strom vom ländlichen Zweitwohnsitz in die städtische Wohnung zu liefern.
Das P2P-Modell könnte also nicht nur für den niederschwelligen Bereich eine geeignete Form des Energy-Sharings sein und damit zur Dezentralisierung der Stromerzeugung beitragen. Vielmehr könnten sich durch dessen Implementierung auch Potentiale für die Erweiterung von konzerninternen Stromerzeugungs- und -verbrauchssynergien ergeben.
Nahebereich – nun auch für BEG?
Gemäß derzeit (noch) geltender Gesetzeslage können die Teilnehmer:innen einer BEG – im Gegensatz zur EEG – österreichweit Strom gemeinsam nutzen. Für die BEG kommt es auf den sogenannten Nahebereich somit aktuell nicht an, was allerdings auch zur Konsequenz hat, dass für die BEG-Teilnehmer:innen die vergünstigten Netzentgelte, welche für die Teilnehmer:innen von EEG zur Anwendung kommen, nicht gelten.
Der Nahebereich wird im § 61 Abs 5 ElWG (neu) definiert und soll nach dem aktuellen Gesetzesentwurf nun auch für BEG gelten. Vereinfacht dargestellt dürften zukünftig also auch BEG-Teilnehmer:innen, deren Erzeugungs- bzw. Verbrauchsanlagen maximal an derselben Mittelspannungs-Sammelschiene im Umspannwerk (Regionalbereich) hängen, von den Vergünstigungen bei den Netzentgelten profitieren.
Weiters dürfen nach dem aktuellen Wortlaut des Gesetzesentwurfs (näher definierte) “große Unternehmen” nur mehr dann an einer BEG teilnehmen, wenn deren Netzanschlusspunkt im Nahebereich liegt. Die Einführung dieser neuen Regelungen im ElWG würde bedeuten, dass es – im Unterschied zum geltenden ElWOG 2010 – für große Unternehmen womöglich nicht mehr sinnvoll ist, an einer BEG mitzuwirken. Da dies – wie Stimmen in der Branche propagieren – sowohl den Aufschwung der Energiegemeinschaften dämpfen würde als auch dem gesetzgeberischen Ziel der Dezentralisierung der Stromerzeugung konterkarieren könnte, ist – jüngsten Meldungen nach – in diesem Punkt aber noch mit einer Änderung des ElWG-Textes im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu rechnen. Es ist daher davon auszugehen, dass auch für große Unternehmen künftig wohl effizientes Energy-Sharing möglich sein wird. Wir verfolgen hier die weiteren gesetzgeberischen Schritte mit höchster Aufmerksamkeit und informieren über Neuerungen.
(Neue) Schwellenwerte
Mit dem derzeitigen Gesetzesentwurf sollen drei neue Schwellenwerte eingeführt werden, die weitere Stolpersteine für die gemeinsame Energienutzung darstellen könnten:
Jeder sogenannte “aktive Kunde” soll berechtigt sein, zusätzlich zu seinem bestehenden Stromliefervertrag (z.B. mit einem Energieversorgungsunternehmen) an einer gemeinsamen Energienutzung (d.h. im Rahmen einer GEA, BEG, EEG oder einem P2P-Modell) mit Stromerzeugungsanlagen bzw. Energiespeicheranlagen mit einer Maximalkapazität von bis zu 6 MW teilzunehmen, wobei dieser Schwellenwert für jeden aktiven Kunden und nicht für die gemeinsame Energienutzung insgesamt gelten soll. Der Strombezug aktiver Kunden aus der gemeinsamen Energienutzung soll allerdings unbeschränkt möglich sein.
Nach dem Wortlaut des derzeitigen ElWG-Entwurfs handelt es sich bei diesem 6 MW-Schwellenwert um eine absolute Teilnahmegrenze, sodass bei Überschreiten überhaupt kein Recht auf Teilnahme an der gemeinsamen Energienutzung mit dieser Erzeugungs-/Speicheranlage bestehen soll. Wie auch kritische Stimmen aus der Praxis anmerken, würde damit die Teilnahme von größeren Erzeugungsanlagen (z.B. Windparks) wesentlich erschwert werden.
Dem Vernehmen nach soll es daher auch hier noch eine Anpassung des ElWG-Textes im weiteren Gesetzgebungsverfahren geben. So könnte etwa eine Regelung gefunden werden, wonach größere Erzeugungsanlagen mit einer Leistung bis zu 6 MW – selbst wenn diese insgesamt eine höhere Leistung aufweisen – an der gemeinsamen Energienutzung teilnehmen könnten.
Entscheidend ist auch, dass diese 6 MW-Schwelle nicht für jene Erzeugungsanlagen gelten soll, welche in der Betriebs- und Verfügungsgewalt der Energiegemeinschaften stehen. So soll etwa die Verpachtung von größeren Anlagen an Rechtsträger der BEG oder EEG (also etwa an den Verein) weiterhin möglich bleiben.
Das ElWG legt außerdem fest, dass Haushaltskunden mit Erzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazität von bis zu 30 kW und alle sonstigen Kunden mit Erzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazität von bis zu 100 kW, die gemeinsam Energie nutzen, regulatorisch weder als Lieferanten noch als Stromhändler zu qualifizieren sind. Werden diese Schwellenwerte überschritten, muss der aktive Kunde jedoch den Lieferantenverpflichtungen gemäß ElWG nachkommen. Auch wenn diese Verpflichtungen an einen sogenannten “Organisator” übertragen werden können, könnte sich diese gesetzliche Änderung auch negativ auf Energiegemeinschaften auswirken, da – anders als im ElWOG 2010 – die Energieversorgung im Rahmen von Energiegemeinschaften nicht (mehr) generell von der Lieferanteneigenschaft ausgenommen ist. Der neue Gesetzesentwurf enthält eine derartige Regelung nicht (mehr), womit also auch neue regulierungsrechtliche Anforderungen an die Marktteilnehmer:innen einhergehen.
Fazit und Key Take-Away
Insgesamt ist ein möglicher Paradigmenwechsel im Hinblick auf die Energiegemeinschaften zu beobachten. Nach derzeit geltendem Recht unterscheidet sich die BEG von der EEG nämlich zentral dadurch, dass für BEG gerade keine geografische Begrenzung vorgesehen ist. Nach dem derzeit vorliegenden ElWG-Entwurf müssten BEG zukünftig aber – neben den oben genannten Schwellenwerten der Erzeugungsanlagen ihrer Mitglieder – auch die regulatorische Schranke beachten, wonach große Unternehmen zumindest im Regionalbereich angesiedelt sein müssen. Wie bereits erwähnt ist aber zu erwarten, dass hier noch einmal im Gesetzestext nachgeschärft wird, um die Attraktivität der BEG auch für große Unternehmen beizubehalten.
Die mit dem ElWG-Paket verbundenen Änderungen bzw. Unsicherheiten für Energiegemeinschaften könnten – zumindest übergangsmäßig – den bisherigen Boom an Neugründungen von Energiegemeinschaften dämpfen. Selbst wenn durch die Implementierung des P2P-Modells insbesondere die dezentrale Stromerzeugung/-nutzung im kommunalen Bereich wohl (noch) attraktiver wird, werden unserer Einschätzung nach aber die bereits heute von den Marktteilnehmern gut angenommenen Energy-Sharing-Modelle der Energiegemeinschaften nicht verdrängt werden.
Die neuen (regulatorischen) Vorgaben des ElWG werden daher bei der Umsetzung neuer Energy-Sharing-Modelle – auch im unternehmerischen Bereich – zu berücksichtigen sein. Daneben kann sich aus dem neuen ElWG auch Anpassungsbedarf für bereits bestehende Energiegemeinschaften ergeben.
Wir beraten Sie sehr gerne rechtlich bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projektidee und erwarten das finale Gesetz schon heute mit Hochspannung.