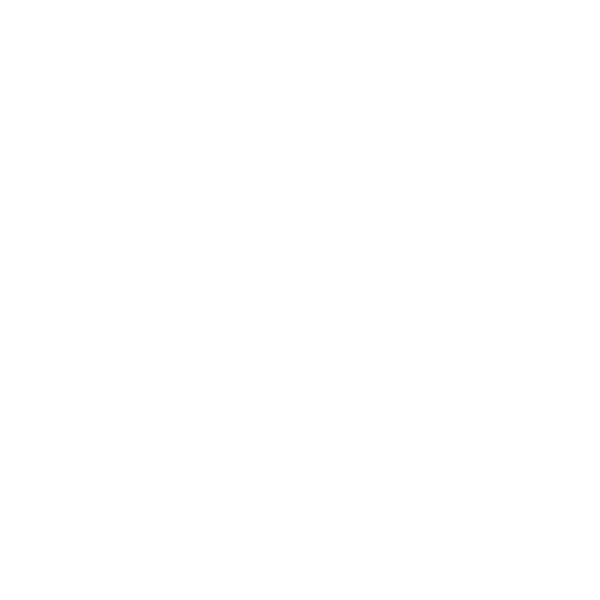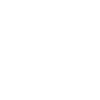05.05.2025
Der Oberste Gerichtshof als Kartellobergericht gibt in seiner ersten Entscheidung zur Transaktionswertschwelle Guidance, wie die “erhebliche Inlandstätigkeit” im Rahmen der Prüfung der Anmeldepflicht zu beurteilen ist. Auch nach der ersten höchstgerichtlichen Entscheidung bleibt vieles unklar, aber die engere Auslegung durch den OGH ist zu begrüßen. (OGH 26.03.2025, 16 Ok 2/25t).
Die Einführung der Transaktionswertschwelle in der österreichischen Fusionskontrolle im Jahr 2017 führte zu einer fundamentalen Veränderung, indem es bei der Frage der fusionskontrollrechtlichen Anmeldepflicht nicht mehr nur auf die Umsätze der beteiligten Unternehmen ankam, sondern eine Anmeldepflicht auch in Frage kam, wenn das Zielunternehmen keinen oder nur einen sehr geringen Umsatz erzielte. Die wesentlichen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Transaktionswertschwelle sind insbesondere (i) ein Transaktionswert von mehr als EUR 200 Millionen und (ii) dass das Zielunternehmen in Österreich in erheblichem Umfang tätig ist.
Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zu Ergänzung der Schwellenwerte mit der Transaktionswertschwelle war man mit nur fünf zusätzlichen Anmeldungen noch von einer sehr geringen Anzahl an Anmeldungen ausgegangen, die sich auf die Transaktionswertschwelle stützen würden. Die Praxis zeigte aber, dass die Anzahl der zusätzlichen Anmeldungen viel höher war (2023: 18; 2022: 26; 2021: 42; 2020: 18; 2019: 15). Die BWB hat in ihrem gemeinsamen Leitfaden mit dem deutschen Bundeskartellamt zwar ausführliche Auslegungshilfen zur “erheblichen Inlandstätigkeit” gegeben, die gerade zitierten Zahlen zeigen aber, dass viele Anmeldungen wohl auch aus Vorsichtsgründen erfolgten, weil eine Anmeldepflicht eben nicht ausgeschlossen werden konnte. Bislang hatte es zwei Vollzugsverbotsfälle vor dem Kartellgericht im Zusammenhang mit der Transaktionswertschwelle gegeben. Die Fälle basierten auf Settlements. Am 26.03.2025 erließ der OGH die erste Entscheidung zur Transaktionswertschwelle.
Was war passiert?
Ausgangspunkt war ein Zusammenschluss, welcher im Herbst 2024 bei der Bundeswettbewerbsbehörde (“BWB“) angemeldet wurde. Das verfahrensgegenständliche Zielunternehmen entwickelt und vertreibt Transkatheter-Aortenklappenersatzprodukte für die Behandlung schwerer, symptomatischer Aortaklappen-Insuffizienz. Das Zielunternehmen verfügt über keine Niederlassung in Österreich. Im Jahr 2023 erzielte das Zielunternehmen EUR 57.000 Umsatz in Österreich, im Jahr 2024 betrug der Inlandsumsatz EUR 95.000.
Die Anmeldung durch die Erwerberin erfolgte (wie bei potentiellen Transaktionswertfällen häufig) rein vorsorglich, da das Zielunternehmen weder die nach § 9 Abs 1 Z 2 KartG erforderlichen Umsätze im Inland erzielte noch – nach Ansicht der Erwerberin – eine erhebliche Inlandstätigkeit im Sinne des
§ 9 Abs 4 Z 4 KartG entfaltete.
Sowohl die BWB als auch der Bundeskartellanwalt beantragten eine vertiefte Prüfung des Falls beim Kartellgericht. Die Frage der “erheblichen Inlandstätigkeit” wurde somit im Rahmen eines Phase II-Verfahrens geklärt: Das Kartellgericht wies die Prüfungsanträge mit der Begründung zurück, dass mangels Überschreitens der Umsatzschwellen sowie wegen fehlender erheblicher Inlandstätigkeit kein anmeldepflichtiger Zusammenschluss vorliege. Dagegen erhoben die BWB und der Bundeskartellanwalt Rekurs.
Zur Entscheidung
Das KOG stellte zunächst klar, dass die erhebliche Inlandstätigkeit im Zeitpunkt der (geplanten) Durchführung des Zusammenschlusses vorliegen muss. Auf den Zeitpunkt der Anmeldung sei hingegen nicht abzustellen. Eine mögliche oder geplante Tätigkeit nach dem Zeitpunkt der (geplanten) Durchführung habe keine Relevanz für das Vorliegen einer erheblichen Inlandstätigkeit.
Für die Beurteilung der erheblichen Inlandstätigkeit sind – neben der Berücksichtigung eines Standorts im Inland (welchen es im vorliegenden Fall nicht gab), welcher eine wirtschaftliche Tätigkeit gegenüber inländischen Kunden entfaltet – anerkannte Maßzahlen der jeweiligen Branche heranzuziehen. Als in der Branche relevante Maßzahlen kommen dem KOG zufolge alle Indikatoren in Betracht, die eine Zuordnung einer Tätigkeit zu Kunden im Inland ermöglichen.
Die Erwirkung der Zulassung eines Produkts oder die Registrierung eines Patents begründet dem KOG zufolge noch keinen Wettbewerb um einen (zuordenbaren) Kunden, sodass aus der EU-weiten Zulassung des vom Zielunternehmen vermarkteten Produkts oder der Registrierung eines (Europäischen) Patents für mehrere Staaten (noch) keine Inlandstätigkeit des Zielunternehmens folgt. Zudem ist die Anzahl oder das Entwicklungsstadium von sich in Entwicklung befindlichen “Pipeline-Produkten” des Zielunternehmens (noch) keinen inländischen Kunden zuordenbar und begründet daher auch keine aktuelle Tätigkeit dieses in Österreich.
Eine der für die Praxis zentralste Aussage des KOG ist, dass dem Marktanteil eines Zielunternehmens am relevanten Markt in Österreich keine entscheidende Bedeutung bei der Beurteilung der Erheblichkeit zukommt. Das KOG begründet dies damit, dass andernfalls die für Aufgriffskriterien geforderte leichte Handhabbarkeit durch möglicherweise komplexe Vorfragen zur Marktabgrenzung gefährdet wäre, die der Gesetzgeber aber bewusst bei der Festlegung der Aufgriffskriterien vermied.
Ferner hebt das KOG hervor, dass soweit sich die Inlandstätigkeit aus Umsatzerlösen ableiten lässt, inländische Umsatzerlöse, welche die ein Millionen Euro Schwelle (vgl § 9 Abs 1 Z 2 KartG) nicht erreichen, nicht auf eine Tätigkeit in erheblichen Umfang hindeuten. Unerheblich bei der Beurteilung ist jedoch das Verhältnis der Tätigkeit des Zielunternehmens im Inland im Vergleich zur Tätigkeit in anderen Ländern.
Im vorliegenden Fall verneinte der OGH die Erheblichkeit der Inlandstätigkeit: Das Zielunternehmen hatte keinen Standort im Inland und seine Geschäftstätigkeit bestand in den Kalenderjahren 2023 und 2024 darin, dass es sein Produkt insgesamt acht Mal an einen einzigen Abnehmer verkaufte. Weder deutet der im Kalenderjahr 2024 dadurch generierte Umsatz (von – deutlich – unter EUR 1 Mio.) auf einen im Hinblick auf die österreichische Marktstruktur ins Gewicht fallenden Umfang ihrer Tätigkeit hin, noch konnte ein solcher Umfang aus der Anzahl der Kunden oder der Geschäftsabschlüsse abgeleitet werden.

Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung des KOG schränkt die Auslegung der Transaktionswert-Schwelle ein. So weicht das KOG mit der Klarstellung, dass bei der Beurteilung der Inlandstätigkeit nicht der konkrete Marktanteil des Zielunternehmens im Inland entscheidend ist, auch von der Entscheidungspraxis des Kartellgerichts und der bestehenden Rechtsauffassung im Leitfaden der BWB ab (vgl OLG Wien als Kartellgericht, 27 Kt 9/21g, Salesforce). Im Lichte der ergangenen Entscheidung wird damit auch der gemeinsame Leitfaden des Bundeskartellamts und der Bundeswettbewerbsbehörde zu überarbeiten sein.
Die Entscheidungsgründe sind zwar fallspezifisch, jedoch wurden für die fusionskontrollrechtliche Beratungspraxis wichtige offene Fragen beantwortet. Letztlich verbleiben bei der Prüfung der Transaktionswert-Schwelle dennoch Unsicherheiten. So zB auf welche konkreten (und wie viele) “Maßzahlen” im jeweiligen Anlassfall abzustellen ist (soweit sich die Inlandstätigkeit nicht aus Umsätzen oder einem Standort ableiten lässt).
Unternehmen, unabhängig von ihrer jeweiligen Branchentätigkeit, sind daher weiterhin gefordert, bei der Beurteilung einer fusionskontrollrechtlichen Anmeldepflicht nach der Transaktionswertschwelle zu prüfen, welche konkreten Indikatoren (neben Umsatzerlösen) herangezogen werden könn(t)en.
Letztlich kann auch die informelle Kontaktaufnahme mit der BWB zu empfehlen sein, um Unsicherheiten auszuschließen – insbesondere im Lichte der zuletzt iZm einem Verstoß gegen das Vollzugsverbot verhängten drakonischen Geldbuße (EUR 70 Mio. – OGH 28.01.2025, 16 Ok 5/24g).